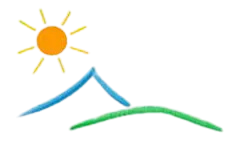Jeder Mensch ist geprägt von seiner persönlichen und ethnischen Konstitution sowie ganz individuellen Erfahrungen. Hüther et al. beschreiben sehr anschaulich aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, nach denen Menschen ihre eigenen Erfahrungen sehr individuell verarbeiten. So bilden sich ganz einzigartige neuronale Verknüpfungen und ebenso einzigartige Symptomatiken, die wiederum eine Bandbreite an Bewältigungsmustern und -strategien produzieren. Wenn die so gebildeten neuronalen Netzwerke nun häufig erfolgreich genutzt werden, können sie etabliert und ausgebaut werden. Je früher in der Kindheit solche Reaktionsmuster erworben werden, desto älter und tiefergelegen sind die Bereiche des Gehirns, in denen diese Muster gebildet und gespeichert werden. Später gebildete äußere Hirnareale sind sehr viel komplexer als die älteren, früher entstandenen. Diese Komplexität kann bei schwerwiegenden psychischen Belastungen zu einer übermäßigen Erregung der genannten Areale führen, sodass sie nicht mehr richtig funktionieren.
In der Regel hilft sich das Gehirn indem es Verhaltensmuster aktiviert, die in der frühen Kindheit erworben und in deutlich stabileren Gehirnarealen gespeichert sind. Bei traumatisch erlebten Ereignissen, die je nach Schwere der Traumatisierung oft wiederholt erlebt werden müssen, versagen diese Bewältigungsmechanismen. Daraufhin wird automatisch eine Art Notfallprogramm aktiviert. Dabei kommt es entweder zu einer Fluchtreaktion, die durch den Sympathikus – einen Teil des autonomen Nervensystems – ausgelöst wird, oder, wenn Flucht nicht möglich ist, zu einer durch den Parasympathikus induzierten Erstarrung. Die Funktionen des Hippocampus und des Frontalhirns, die für das Speichern von Erfahrungen und den dazugehörigen Sinnesreizen verantwortlich sind, werden in solchen Situationen blockiert. Dadurch wird das Erlebte fragmentarisch und zusammenhangslos abgespeichert. Die dabei extrem aktivierten neuronalen Netzwerke verknüpfen sich umso intensiver, je stärker die entsprechenden emotionalen Zentren im Gehirn aktiviert werden. Zusätzlich werden im limbischen System Angstreaktionen ausgelöst, während im Stammhirn körperliche Reaktionen wie erhöhter Herzschlag, Blutdruckanstieg und Körperstarre produziert werden. Diese körperlichen Reaktionen stehen in Verbindung mit vom präfrontalen Cortex gesteuerten Gefühlen wie Schuld, Ohnmacht und Hilflosigkeit.
Die so geformten neuronalen Netzwerke können jederzeit durch äußere Schlüsselreize, wie Sinneswahrnehmungen, Gefühle oder Körperreaktionen, reaktiviert (angetriggert) werden. Analog dazu beschreiben Klinghardt et al. Traumata als Verletzungen auf körperlicher, emotional-energetischer oder psychischer Ebene, die – bleiben sie unbehandelt – zu Blockaden in der Informationsverarbeitung im Gehirn führen. Dadurch wird der Zugriff auf Erinnerungen, Emotionen und Intuitionen eingeschränkt, wodurch traumatische Erlebnisse nachhaltige Wirkungen auf den gesamten Organismus hinterlassen. Zu den häufigen Folgen zählen Schlafstörungen, Ängste, somatische Reaktionen und weitere Beschwerden.
Je nach Schweregrad der Verletzung können auch bleibende anatomische Veränderungen im Gehirn auftreten, wie etwa das Schrumpfen des Hippocampus – eines Gehirnareals, das für das Erinnern und die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist. Ebenso können Veränderungen im Hormonhaushalt sowie in der Gensteuerung folgen. Besonders gravierend sind die Auswirkungen, wenn eine Traumatisierung früh im Leben stattfindet, da hierbei direkt die Prozesse der Hirnentwicklung beeinflusst werden. Das Fundament des Gehirns wird dadurch maßgeblich verändert und bildet die Grundlage für die weitere Strukturierung des Gehirns.
Eine fortlaufende Traumatisierung birgt die Gefahr, dass durch wiederholtes Dissoziieren in Stresssituationen autonome Verhaltensmuster entstehen, die sich schließlich zu eigenständigen Teilidentitäten entwickeln können – ein Phänomen, das als dissoziative Identitätsstörung bekannt ist. Der Begriff der multiplen Persönlichkeit beschreibt diesen Zustand.
Nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gehirn deutlich plastischer, als lange Zeit angenommen wurde. Das bedeutet, dass entstandene neuronale Vernetzungen über die Lebenszeit hinweg zu neuen Nutzungsmustern umgestaltet werden können. Dieser Umstrukturierungsprozess ist jedoch sehr komplex und langwierig. Je früher die beschriebenen neuronalen Verschaltungen entstanden sind, desto schwieriger gestaltet sich deren Auflösung.
Eine achtsame und behutsame Vorgehensweise ist daher von elementarer Bedeutung, um Retraumatisierungen zu vermeiden. Traumapädagogik und Traumatherapie stellen wirksame Ansätze dar, um die notwendigen Umstrukturierungsprozesse im Gehirn anzustoßen und eine Heilung zu fördern.